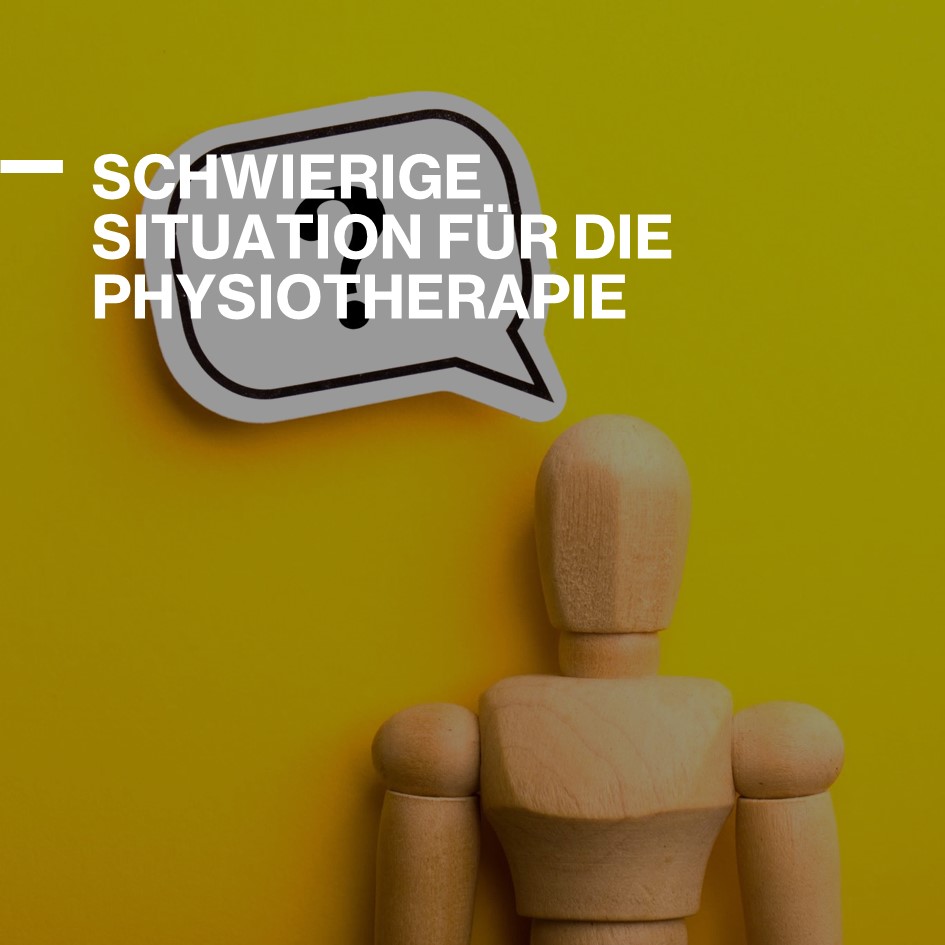Am 5. Mai 2025 veranstaltete das Forschungslabor Physiotherapie der OTH Regensburg sein fünftes „mit-Physio“-Netzwerktreffen und feierte damit ein erstes kleines Jubiläum. Über 50 Fachkräfte aus Praxis und Wissenschaft fanden sich im Regensburg Center of Health Sciences and Technology ein, um gemeinsam aktuelle, praxisnahe Entwicklungen in der Physiotherapie kennenzulernen und zu diskutieren.
Thema: Quantitative Sensorische Testung
Unter der Leitung von Prof. Dr. Andrea Pfingsten widmete sich das diesmalige Netzwerktreffen der Frage, wie sich die Differenzierung von nozizeptiven, neuropathischen und noziplastischen Schmerzen auch jenseits der aufwändigen Quantitativen Sensorischen Testung (QST) mithilfe einfacher Bedside-Testungen sicherstellen lässt. Während die QST in Forschungskontexten einen hohen Stellenwert genießt, erweist sie sich im klinischen Alltag oft als zu zeit- und kostenintensiv. Daher stellte das Team des Forschungslabors die von Zhu et al. (2019) beschriebenen Clinical Sensory Tests sowie ergänzende Tests vor, die gezielt für den Routineeinsatz konzipiert wurden.
Grundlagen der Schmerzphysiologie
Zu Beginn erhielten die Teilnehmenden einen kompakten Überblick über die Schmerzphysiologie und die verschiedenen Schmerzphänotypen. Nozizeptive Schmerzen entstehen durch die Aktivierung von Nozizeptoren bei tatsächlichen oder drohenden Gewebeschädigungen und dienen als Warnsignal des Körpers. Im Unterschied dazu stehen neuropathische Schmerzen, die auf Läsionen oder Erkrankungen des somatosensorischen Nervensystems zurückgehen und häufig mit brennenden oder elektrisierenden Empfindungen einhergehen. Noziplastische Schmerzen schließlich beruhen auf einer veränderten Schmerzverarbeitung im zentralen Nervensystem, obwohl keine eindeutige Gewebeschädigung nachweisbar ist. Auch Mischformen dieser Mechanismen wurden diskutiert, um den Teilnehmenden die Komplexität chronischer Schmerzbilder zu verdeutlichen. Dabei spielte die Rolle neuronaler Plastizität eine zentrale Rolle, da sie erklärt, wie sich wiederholte Reize langfristig auf die Schmerzwahrnehmung auswirken können.
Vorstellung der Bedside-Testungen
Im Anschluss an die theoretische Einführung demonstrierten die Referent*innen Elke Schulze, M.Sc. und Johannis Mertens M.Sc. die wissenschaftlichen Grundlagen und praktischen Abläufe der Clinical Sensory Tests. Im Rahmen dessen wurden sowohl die Gütekriterien als auch die für die Interpretation relevanten Normwerte dargelegt. Ein besonderes Augenmerk wurde auf den direkten Vergleich zwischen den klassischen QST-Verfahren und den schnell umsetzbaren Bedside-Tests gelegt. Ziel war es, den Teilnehmenden aufzuzeigen, für welche Zielsetzung welche Verfahren den sinnvollsten Einsatz finden.
Praktische Übungen in Kleingruppen
In Kleingruppen hatten die Teilnehmenden anschließend die Möglichkeit, die vorgestellten Bedside-Testungen eigenständig anzuwenden. Die Gruppen arbeiteten an Fallbeispielen, verglichen Messergebnisse mit den Referenzwerten und diskutierte die diagnostischen Konsequenzen. So entstanden lebhafte Fachgespräche über praktische Aspekte wie Zeitaufwand, benötigtes Equipment und die Interpretation einzelner Testergebnisse. Dieser praxisorientierte Ansatz ermöglichte es den Anwesenden, die neuen Testverfahren unmittelbar zu erproben.
Kollegialer Austausch und Ausblick
Zum Abschluss des Netzwerktreffens stand der kollegiale Austausch im Vordergrund. Die Teilnehmenden reflektierten die Alltagstauglichkeit der Bedside-Testungen. Das Team des Forschungslabors Physiotherapie der OTH Regensburg bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden für das rege Interesse und die zahlreichen Impulse. Mit vielen neuen Anregungen und voller Vorfreude auf das sechste „mit-Physio“-Netzwerktreffen blickt es nun in Richtung Zukunft.